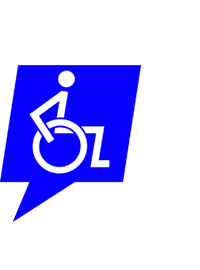Wie hindernisfrei muss eine provisorische Bushaltestelle sein?
Öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen müssen für Menschen mit Behinderung zugänglich und benutzbar sein. So schreibt es das bernische Baurecht vor. Auch nach dem Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes müssen Haltestellen des öffentlichen Verkehrs hindernisfrei sein, also von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe nutzbar. Eine provisorische Bushaltestelle in Bern wurde aber trotzdem zu tief gebaut. Ist das erlaubt?

Neun Monate lang wird die Kornhausbrücke saniert. Sie ist deshalb von Februar bis November für den Verkehr gesperrt. Aus diesem Grund fährt die Buslinie 10 von und nach Ostermundigen eine andere Route. Stadteinwärts biegt sie nach dem Rosengarten auf den Aargauerstalden ab. Hier wurde eine neue provisorische Haltestelle Schönburg als einfache Holzkonstruktion erstellt. Doch sie ist nicht hindernisfrei. Um ein autonomes Ein- und Aussteigen zu erlauben und damit als hindernisfrei zu gelten, müsste die Haltekante mindestens 22 cm über Boden liegen. Gemessen haben wir aber nur 18 cm.
Ich habe deshalb Reto Beer des Tiefbauamts kontaktiert, der auf der Website zur Kornhausbrückensanierung als Kontaktperson aufgeführt ist. Er hat mir geantwortet, dass die Haltestelle nicht höher gebaut werden konnte, weil der Bus sie sonst mit der Front oder dem Heck touchieren könnte, was den Bus beschädigt. Die tiefere Haltekante erlaubt das sogenannte Überstreichen mit dem Bus. Normalerweise würden bei Bushaltestellen «Sonderbordsteine» eingesetzt, die das richtige Anfahren der Haltestelle ermöglichen und die richtige Höhe für das hindernisfreie Ein- und Aussteigen aufweisen. Weil diese solide im Boden verankert werden müssen, wurde hier darauf verzichtet. Er ist sich bewusst, dass die Haltestelle nicht hindernisfrei ist. Eine Alternative wäre für ihn höchstens das Verzichten auf eine Haltestelle gewesen.

Obwohl die Argumente von Reto Beer nachvollziehbar sind, stört mich das Resultat. Denn gemäss Art. 22 Baugesetz des Kantons Bern müssen öffentlich zugängliche Bauten und Anlagen für Menschen mit Behinderung zugänglich und benutzbar sein, d.h. hindernisfrei erstellt werden. Auch nach dem Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) des Bundes müssen Haltestellen des öffentlichen Verkehrs hindernisfrei sein, also von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe nutzbar. Doch während das BehiG Ausnahmen vorsieht, kennt das kantonale Baurecht keine.
Eine Umrüstung oder Abbau ist im konkreten Fall sicher unverhältnismässig. Die Frage stellt sich aber für zukünftige Bauvorhaben: Muss für eine sieben Monate bestehende Bushaltestelle halt eine teurere Bauweise verwendet werden, indem von Anfang an der Sonderbordstein mit dem entsprechenden Fundament eingeplant wird, um das Baurecht einzuhalten? Müsste ansonsten mindestens eine übergeordnete Behörde in einem solchen Fall eine Interessenabwägung vornehmen, zum Beispiel im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens, in dem auch eine Betroffenenorganisation (z.B. Procap) involviert wird? Oder darf eine Behörde tatsächlich eigenmächtig auf eine hindernisfreie Bauweise verzichten und eine Baute oder Anlage erstellen, die das Baurecht verletzt?
Annette Hodel, die Co-Amtsleiterin des Bauinspektorats der Stadt Bern, antwortet hierzu lediglich, dass für die provisorische Haltestelle kein Baugesuch nötig war und das Bauinspektorat deshalb auch keine Interessenabwägung vorgenommen hat. Das Tiefbauamt als Bauherrin sei dafür verantwortlich. Für sie ist der Fall damit erledigt.

Wenn die Einhaltung von baurechtlichen Vorschriften durch eine Behörde plötzlich optional ist, kommt dann das Bauinspektorat nicht in einen Erklärungsnotstand gegenüber privaten Bauherren, bei denen sie gelten sollen? Oder zeigt dieses Beispiel einmal mehr den tiefen Stellenwert der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, die nicht einmal dann gelten, wenn ein Gesetz sie vorschreibt?
Ich verzichte auf eine Anfrage beim Kanton. Ziel ist es ja nicht, dass die provisorische Haltestelle abgebaut wird, sondern dass zukünftig auch provisorische Bushhaltestellen hindernisfrei sind. Das vorliegende Beispiel bleibt für mich ein Armutszeugnis und ein Beleg dafür, dass sich die Behörden schwer damit tun, sich an die seit 2017 bestehende kantonale Gesetzesbestimmung und das seit 2024 geltende Behindertengleichstellungsgesetz zu gewöhnen.